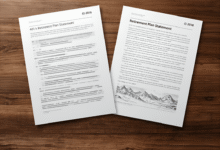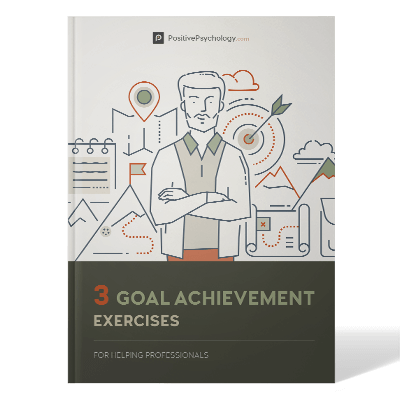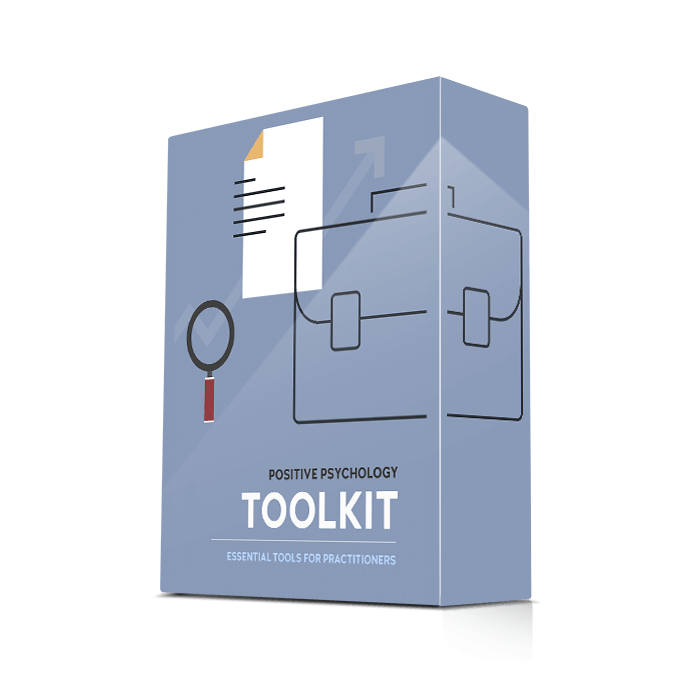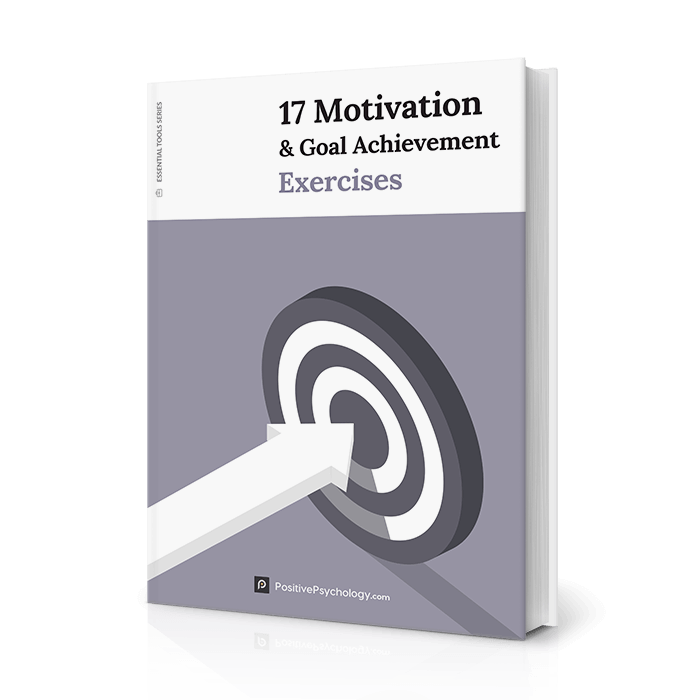Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie in der Therapie Ergebnisse erzielen können?
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie in der Therapie Ergebnisse erzielen können?
Im Rahmen langjähriger Forschungen in der Gemeinde und im Krankenhaus (Paul, 1967; Kiresuk & Sherman, 1968) wurden die Faktoren untersucht, die für das Erreichen positiver Ergebnisse wichtig sind, darunter:
- Die Klient-Therapeut-Beziehung
- Motivation der Klienten zur Teilnahme
- Klienten, die Veränderungen annehmen und Widerstand entgegensetzen
Diese Faktoren sind in allen Therapiestilen vorhanden und waren Diskussionsthema in Therapieausbildungsprogrammen.
In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit der persönlichen und virtuellen Interaktion mit Klienten befassen und sie zu Veränderungen motivieren, wenn sie Widerstand zu leisten scheinen.
Bevor Sie fortfahren, laden Sie sich doch unsere drei Übungen zur Zielerreichung kostenlos herunter. Diese detaillierten, wissenschaftlich fundierten Übungen helfen Ihnen oder Ihren Klienten, umsetzbare Ziele zu formulieren und Techniken zu erlernen, die eine dauerhafte Verhaltensänderung bewirken.
Dieser Artikel enthält:
So binden Sie Klienten in die Therapie ein: 6 Schritte
Sie können häufig mit Kunden in Kontakt treten, indem Sie sich die Frage stellen: „Kann ich eine Verbindung zu ihnen aufbauen?“
Dies kann bedeuten, eine persönliche Verbindung zu ihnen aufzubauen und kann als Erfolgsindikator in der Therapie angesehen werden (Hill, Chui & Baumann, 2013). Wie gelingt uns das? Hier sind sechs Schritte, die Therapeuten dabei helfen:
1. Stellen Sie sicher, dass der Kunde im Mittelpunkt steht
Dies mag zwar offensichtlich klingen, ist jedoch möglicherweise der wichtigste Schritt, der jedoch leicht übersehen werden kann.
Der Fokus muss auf dem Klienten liegen. Zu Beginn, in der Mitte und am Ende jeder Sitzung sollten die Gedanken, Gefühle und Handlungen des Klienten im Mittelpunkt stehen. Zu den Praktiken, die Therapeuten helfen können, konzentriert zu bleiben, gehören aktives Zuhören und das Klären des eigenen Geistes vor Beginn einer Sitzung.
2. Vertraulichkeit einführen, wahren und wahren
Wenn Therapeuten den Fokus auf ihre Klienten richten, kann dies dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen, einen wichtigen Aspekt der Therapeut-Klienten-Beziehung. Ohne Vertrauen fühlen sich Klienten möglicherweise nicht wohl dabei, sich dem Therapeuten zu öffnen und ihm zuzuhören.
Vertrauen bedeutet für Klienten nicht nur, dass sie das Gefühl haben, mit Therapeuten sprechen zu können, sondern auch, dass ihnen zu Beginn der Therapie versichert wird, was Vertraulichkeit bedeutet und wie die Privatsphäre gewahrt wird.
Dies kann sich darauf beziehen, wo und wie klinische Notizen gespeichert werden, aber auch darauf, wann ein Versprechen gebrochen werden muss, beispielsweise wenn der Klient droht, sich selbst oder anderen Schaden zuzufügen.
3. Berücksichtigen Sie die Präferenzen des Klienten bei der Entscheidungsfindung zur Behandlung
Dieses Gespräch ist besonders wichtig für Klienten, die zum ersten Mal in die Therapie einsteigen oder nur wenig Zeit dafür haben.
Informieren Sie Ihren Klienten über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und berücksichtigen Sie die Gründe für die Teilnahme an der Therapie. Dies sollte entweder bei der ersten Anfrage oder während der ersten Sitzung geschehen.
Wenn der Therapeut aufmerksam zuhört und die Präferenzen des Klienten bei der Entscheidungsfindung für die Behandlung berücksichtigt, ist der Klient stärker motiviert, sich zu engagieren.
4. Strukturieren Sie die Sitzung
Wenn Vertrauen aufgebaut ist, kann eine Struktur den Klienten dabei helfen, innerhalb der Sitzungsgrenzen zu bleiben.
Die Struktur der Therapie ist bei den einzelnen Therapeuten unterschiedlich. Manche haben Protokolle dafür, was zuerst und was zuletzt kommt. Dies hängt oft von der Art der Therapie ab, von der kognitiven Verhaltenstherapie über die lösungsorientierte Therapie bis hin zur psychodynamischen Therapie.
5. Verwenden Sie einen eklektischen Ansatz
Was die Struktur betrifft, können Klienten das Interesse an der Therapie verlieren, wenn nur ein therapeutischer Ansatz verfolgt wird und immer dieselben Techniken und Methoden zum Einsatz kommen.
Eine eklektische oder integrierte Therapieform, die einzigartige Elemente in die Therapie einbringt und bei den Klienten zu größerer Begeisterung für den therapeutischen Prozess führen kann, kann auch dazu führen, dass sich der Therapeut stärker eingebunden fühlt.
6. Übungsfragen
Die Vermittlung von Interviewfähigkeiten ist Teil der Ausbildung vieler Therapeuten und kann auch einen wichtigen Teil der therapeutischen Allianz bilden (Ardito & Rabellino, 2011).
Denken Sie in jedem guten Gespräch daran, offene Fragen zu stellen, um mehr Details vom Klienten zu erfahren. Es ist wichtig, neutral, aber dennoch neugierig zu bleiben. Offene Fragen sind besonders in der ersten Sitzung wichtig, da Therapeuten ihre Klienten kennenlernen und verstehen lernen.
Den Klienten Neugier zu zeigen und die richtigen Therapiefragen zu stellen, sind wichtige Aspekte für die Stärkung der therapeutischen Allianz, den Aufbau einer Vertrauensbeziehung und die Aufrechterhaltung von Empathie und positiver Wertschätzung. All dies sind Schlüsselpunkte beim Aufbau von Beziehungen zu Klienten, die dazu beitragen können, notwendige Veränderungen herbeizuführen (Bedi, Davis & Williams, 2005).
Tipps zur Teletherapie: Virtuelle Einbindung Ihrer Klienten
 Die oben genannten Schritte können Kunden dabei helfen, sich zu engagieren. Was passiert jedoch, wenn Kunden sich nicht persönlich treffen können?
Die oben genannten Schritte können Kunden dabei helfen, sich zu engagieren. Was passiert jedoch, wenn Kunden sich nicht persönlich treffen können?
Es gibt drei wichtige Tipps, die Therapeuten dabei helfen können, sich in der heutigen virtuellen Welt zurechtzufinden.
Kombinierte Pflege
Die Nutzung eines Blended-Care-Ansatzes ist für Klienten wichtig, die sich mit der Verwendung nur einer Methode der virtuellen Kommunikation, wie etwa der Videokonferenztechnologie, nicht so wohl fühlen.
Stattdessen stehen Therapeuten per SMS, Chat oder Instant Message zur Verfügung – auf für den Klienten bequeme Weise. Diese flexiblen Kommunikationsmöglichkeiten können dazu beitragen, die Kundenbindung zu erhöhen (Dowling & Rickwood, 2013).
Die Privatsphäre des Kunden muss jedoch jederzeit gewahrt bleiben und herkömmliche Videokonferenz- und Textmethoden bieten keine sichere, DSGVO-konforme Kommunikation.
Ein Teletherapie-Tool wie Quenza bietet sichere Kommunikation, eine bequeme Möglichkeit zur Interaktion mit Kunden und Effizienz, da dem Kunden individuelle Übungen zugewiesen werden können.
Beseitigen Sie Ablenkungen
Teletherapie ist zwar praktisch, da die Patienten die Therapeuten von zu Hause aus treffen können, es ist jedoch entscheidend, störende Hindernisse zu beseitigen.
Bitten Sie einen Klienten, sich in einen anderen Teil seines Zuhauses zu begeben, z. B. von der Küche in ein privates Zimmer, und bitten Sie ihn, alle Geräte auszuschalten. So stellen Sie sicher, dass das Engagement des Klienten gewährleistet ist.
Den therapeutischen Prozess transparent machen
Wenn Sie sicherstellen, dass die Klienten verstehen, wie die Therapie bei einem virtuellen Treffen abläuft, können Sie ihnen dabei helfen, engagiert zu bleiben.
Klienten wissen möglicherweise nicht, wie sie eine Sitzung beenden sollen oder was bei einem Internetausfall passieren kann. Ein vorher festgelegter Plan (z. B. der Therapeut ruft den Klienten so schnell wie möglich zurück, wenn die Internetverbindung ausfällt, oder der Therapeut startet einen Countdown mit dem Klienten, bis die Sitzung endet) kann Vertrauen, Rapport und Engagement fördern, da Transparenz erreicht und verstanden wird.
Wie man Beratungsklienten zu Veränderungen motiviert
Auf die Frage, was ihnen das Gefühl gebe, ihre Ziele in der Therapie zu erreichen, erwähnten die Klienten, dass sie positive Veränderungen in ihrem Leben herbeigeführt hätten (Binder, Holgersen & Nielsen, 2010).
Beim Versuch, Veränderungen herbeizuführen, können Therapeuten jedoch auf Widerstand seitens der Klienten stoßen (mehr dazu weiter unten). Therapeuten sollten sich fragen, wie sie ihre Klienten zu Veränderungen motivieren können.
Motivierende Gesprächsführung ist ein jahrzehntealtes Konzept (Rollnick & Miller, 1995) und umfasst drei Prinzipien, die für die Förderung von Veränderungen nützlich sind:
1. Empathie durch reflektiertes Zuhören ausdrücken
Klienten, die sich ändern möchten, haben möglicherweise selten das Gefühl, dass ihnen zugehört wird. Wenn Sie den Klienten ihre Meinung mitteilen, kann ihnen das dabei helfen, sich auf die bevorstehende Veränderung vorzubereiten.
Reflektiertes Zuhören ist während der gesamten Therapiesitzung möglich, kann aber besonders nützlich sein, wenn Therapeuten das Gefühl haben, mit nicht reagierenden Klienten nicht weiterzukommen. Klienten zu zeigen, dass ihnen zugehört wird, zeugt von Empathie und schafft so Vertrauen – Eigenschaften, die Klienten spüren möchten, wenn sie Veränderungen annehmen.
2. Entwicklung einer Diskrepanz zwischen den Zielen des Klienten und seinem aktuellen Verhalten
Wenn Klienten verstehen, dass ihr aktuelles Verhalten ein Hindernis darstellen kann, können sie sich besser auf Veränderungen vorbereiten. Beispielsweise möchten Klienten ihre Wut reduzieren, stellen aber fest, dass ihr Stress in bestimmten Situationen, wie beispielsweise bei der Arbeit, zu Wut führt.
Sobald die Klienten verstehen, wie ihr aktuelles Verhalten sie von einer Veränderung abhält, können sie die Gründe darlegen, warum überhaupt eine Veränderung stattfinden sollte.
Darüber hinaus können Klienten durch die Anwendung reflektierter Zuhörfähigkeiten und die Vermeidung von Streit erkennen, wie ihr aktuelles Verhalten sie möglicherweise daran hindert, Ziele zu erreichen, die zu Veränderungen führen.
3. Unterstützung von Selbstwirksamkeit und Optimismus
Optimismus gegenüber Klienten ist nicht nur in der Welt der positiven Psychologie wichtig; Klienten fällt es möglicherweise schwer zu glauben, dass sie eine Verhaltensänderung einleiten oder aufrechterhalten können.
Nachdem Sie eine Beziehung und Vertrauen aufgebaut und den Klienten zugehört haben, kann es zu mehr Selbstwirksamkeit führen, wenn Sie ihnen gegenüber optimistisch sind.
Dies kann dadurch erreicht werden, dass den Klienten ein Verantwortungsgefühl für die Entscheidung und Durchführung persönlicher Veränderungen vermittelt wird.
Was aber, wenn ein Klient kein Vertrauen in den Therapieansatz hat? Wenn man den Klienten die Hoffnung vermittelt, dass es alternative Ansätze gibt – und wenn ein Ansatz nicht funktioniert, kann ein anderer gewählt werden –, kann dies zu mehr Optimismus, Überzeugung und Motivation führen, dass eine Veränderung möglich ist.
Einbindung widerspenstiger Klienten erklärt
Wenn erst einmal eine Beziehung und Vertrauen aufgebaut sind und die Klienten motiviert sind, Veränderungen anzunehmen, bedeutet das nicht, dass sie die Veränderungen auch beibehalten werden.
Klienten können sich teilweise deshalb gegen Veränderungen sträuben, weil Therapeuten möglicherweise nicht über die Technik verfügen, um mit dem umzugehen, was im Moment vor sich geht, oder weil sie die Welt des Klienten nicht vollständig verstehen, um zu erkennen, warum er so reagiert, wie er es tut (Nienhuis et al., 2018).
Die Schlüsselwörter, die hier hervorstechen, sind im Moment. Klienten können die Veränderung in einer Sitzung akzeptieren, in der nächsten jedoch anders empfinden.
Es gibt mehrere Empfehlungen, was Therapeuten tun können, um mit widerstrebenden Klienten umzugehen.
Seien Sie kein Experte
 Vermeiden Sie die Position des „Experten“. Je widerstrebender der Klient ist, desto weniger Wissen möchten die Therapeuten vermitteln.
Vermeiden Sie die Position des „Experten“. Je widerstrebender der Klient ist, desto weniger Wissen möchten die Therapeuten vermitteln.
Wenn die Klienten eine zusätzliche Motivation zur Veränderung verspüren, können die Therapeuten weiteres Wissen vermitteln.
Machen Sie keine Absprachen mit Kunden
Diese Position sollte in allen Aspekten der Therapie eingenommen werden, insbesondere aber, wenn sich die Patienten gegen Veränderungen wehren.
Es ist hier wichtig, den Standpunkt des Klienten durch Empathie, nicht durch Sympathie zu verstehen. Klienten können fühlen mehr motiviert zur Veränderung, wenn sie ein Verantwortungsgefühl verspüren Zu ändern.
Verlangsamen Sie das Tempo
Verlangsamen Sie das Tempo, wenn die Klienten sich nicht ändern möchten, da dies daran liegen kann, dass der Therapeut die Techniken überstürzt durchführt.
Die Idee besteht darin, kleine Schritte zu unternehmen und jeweils eine Technik nach der anderen anzuwenden. Reflektiertes Zuhören ist ebenfalls wichtig, ebenso wie die Rückbesinnung auf die zu Beginn der Sitzungen festgelegten Ziele des Klienten.
Konzentrieren Sie sich auf Details
„Nichts unversucht lassen.“ Das gilt auch für den Umgang mit widerstrebenden Klienten. Wenn sich Klienten nicht ändern wollen, liegt das möglicherweise daran, dass sie das Gefühl haben, dass die Therapeuten ihre Welt nicht verstehen.
Hier kommen die Details ins Spiel. Wenn Therapeuten beispielsweise eine lösungsorientierte Therapie mit ihren Klienten anwenden und nicht genügend Lösungen besprochen werden, kann dies daran liegen, dass der Therapeut nicht genügend Details über den Klienten weiß.
Therapeutische Durchbrüche und die Überwindung von Widerständen gegen Veränderungen können dadurch erzielt werden, dass ein Detail im Leben des Klienten angesprochen und verarbeitet wird, das zuvor möglicherweise nicht besprochen wurde.
Im Umgang mit widerstrebenden Klienten ist es sehr wichtig, Fragen zu stellen und eine offene Neugier zu bewahren.
Wenn man widerstrebenden Klienten geschlossene Fragen stellt, fühlen sie sich möglicherweise eher dazu ermutigt, kurze, einsilbige Antworten zu geben, bei denen nicht auf Details eingegangen wird. Wenn keine Details untersucht werden, kann es sein, dass keine Veränderung eintritt.
Respektieren
Respekt mag selbstverständlich klingen, aber widerstrebende Klienten haben möglicherweise das Gefühl, dass der Therapeut das, was sie in einer Sitzung gesagt haben, nicht respektiert.
Wenn Klienten geschlossene Antworten geben, ist es für Therapeuten wichtig, die Aussagen des Klienten zu respektieren, auch wenn es sich anfühlt, als würden sich die Klienten weiterhin gegen Veränderungen wehren. Beispielsweise kann die Wiederholung von Antworten für Therapeuten ein wichtiges Mittel sein, um zu zeigen, dass sie zuhören.
Emotional zwingende Gründe für Veränderungen
Für Therapeuten kann es eine große Herausforderung sein, widerstrebenden Patienten die logischen Gründe für eine Veränderung zu erklären.
Für Therapeuten, die beispielsweise mit Patienten arbeiten, die Schwierigkeiten mit ihrem Körperbild und der Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts haben, mag es logisch erscheinen, ihnen die Vorteile von Sport und dem Austausch mit anderen in einem Fitnessstudio zu erklären.
Widerstrebende Klienten erkennen die Logik jedoch möglicherweise nicht und suchen stattdessen nach emotionalen Gründen für eine Veränderung. Was treibt den Klienten emotional an? In diesem Fall verbinden Klienten die Übungen mit einer nostalgischen Vergangenheit? Erinnert sie sie an vermisste Familienmitglieder?
Das Finden dieser emotionalen Verbindung kann entscheidend für den Umgang mit Klienten sein, die das Gefühl haben, in der Therapie festzustecken und sich Veränderungen widersetzen.
Hilfreiche Ressourcen von PositivePsychology.com
Auf PositivePsychology.com stehen mehrere Ressourcen zur Verfügung, die bei den in diesem Artikel behandelten Themen hilfreich sein können.
Wenn Sie feststellen, dass Ihre Klienten mehr Motivation benötigen, empfehlen wir Ihnen unseren Artikel „18 Arbeitsblätter, Beispiele und Techniken zur motivierenden Gesprächsführung“. Dieser Artikel bietet wertvolle Arbeitsblätter, mit denen Sie die Motivation und die Gründe für die Teilnahme an der Therapie fördern können, insbesondere bei Patienten, die sich gegen Veränderungen sträuben.
Verwenden Sie zusätzlich zu diesem Artikel unser Arbeitsblatt „Motivationsinterviews: Fähigkeitsfragen“, das mithilfe des Akronyms DARN dabei helfen kann, die Fähigkeiten des Klienten während eines Motivationsinterviews zu ermitteln.
Fällt es Ihren Klienten, die sich gegen Veränderungen sträuben, schwer, Ziele zu finden? Laden Sie unsere drei Übungen zur Zielerreichung herunter. Dieser Leitfaden hilft Ihnen und Ihren Klienten, umsetzbare Ziele zu formulieren, um dauerhafte Veränderungen zu bewirken.
Wenn es um die Erstellung von SMART-Zielen geht, hilft unser Arbeitsblatt „SMART+R-Ziele setzen“ Klienten dabei, Belohnungen in die Zielsetzung in der Therapie einzubauen.
Wenn Sie feststellen, dass es schwierig ist, mit Klienten in Kontakt zu treten, lesen Sie bitte unseren Artikel „6 Phasen der Veränderung: Arbeitsblätter zur Unterstützung Ihrer Klienten“. Dieser Artikel enthält Links zu Arbeitsblättern, stellt sechs Phasen der Veränderung vor und erklärt, warum Veränderung wichtig ist.
Wenn Sie nach wissenschaftlich fundierten Methoden suchen, um anderen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen, finden Sie in dieser Sammlung 17 validierte Motivations- und Zielerreichungstools für Praktiker. Nutzen Sie sie, um anderen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen, indem Sie die neuesten wissenschaftlich fundierten Techniken zur Verhaltensänderung anwenden.
Eine Botschaft zum Mitnehmen
Es wurde viel über die Themen Kundenbindung online und offline und Umgang mit Veränderungen diskutiert, egal ob diese akzeptiert oder abgelehnt werden.
Zwar gibt es Schritte, die den Klienten dabei helfen, engagiert und motiviert zu bleiben, sich zu ändern, doch ist es ebenso wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht nur die Klienten, sondern auch die Therapeuten Veränderungen akzeptieren müssen.
Wenn es bei Veränderung um Wachstum und Anpassung geht, was sich Therapeuten für ihre Klienten wünschen, dann ist es logisch, dass Therapeuten akzeptieren müssen, dass auch sie wachsen und sich anpassen müssen.
Ähnlich wie bei den oben genannten Konzepten der Zielsetzung und der Aufrechterhaltung von Empathie, Vertrauen und Rapport können Veränderungen erreicht werden, wenn Klienten und Therapeuten die Kommunikation teilen, verstehen und wertschätzen.
Wenn man sich daran erinnert, kann eine dauerhafte Veränderung erreicht werden.
Wir hoffen, Ihnen hat dieser Artikel gefallen. Vergessen Sie nicht, unsere drei Übungen zur Zielerreichung kostenlos herunterzuladen.
- Ardito, R., & Rabellino, D. (2011). Therapeutische Allianz und Ergebnis der Psychotherapie: Historischer Exkurs, Messungen und Forschungsaussichten. Grenzen der Psychologie, 2, 270. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00270
- Bedi, R., Davis, M., & Williams, M. (2005). Kritische Ereignisse bei der Bildung der therapeutischen Allianz aus der Sicht des Klienten. Psychotherapie: Theorie, Forschung, Praxis, Ausbildung, 42(3), 311–323. https://doi.org/10.1037/0033-3204.42.3.311
- Binder, P., Holgersen, H., & Nielsen, G. (2010). Was ist ein „gutes Ergebnis“ in der Psychotherapie? Eine qualitative Untersuchung der Sichtweise ehemaliger Patienten. Psychotherapieforschung, 20(3), 285–294. https://doi.org/10.1080/10503300903376338
- Dowling, M., & Rickwood, D. (2013). Online-Beratung und -Therapie bei psychischen Problemen: Eine systematische Überprüfung individueller synchroner Interventionen per Chat. Zeitschrift für Technologie im Human Services, 31(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/15228835.2012.728508
- Hill, C., Chui, H., & Baumann, E. (2013). Neubetrachtung und Neukonzeption des Ergebnisproblems in der Psychotherapie: Ein Argument für die Einbeziehung individualisierter und qualitativer Messungen. Psychotherapie, 50(1), 68–76. https://doi.org/10.1037/a0030571
- Kiresuk, T., & Sherman, R. (1968). Zielerreichungsskalierung: Eine allgemeine Methode zur Bewertung umfassender gemeindebezogener Programme zur psychischen Gesundheit. Zeitschrift für psychische Gesundheit der Gemeinschaft, 4(6), 443–453. https://doi.org/10.1007/BF01530764
- Nienhuis, JB, Owen, J., Valentine, JC, Black, SW, Halford, TC, Parazak, SE, … Hilsenroth, M. (2018). Therapeutische Allianz, Empathie und Echtheit in der individuellen Psychotherapie für Erwachsene: Eine metaanalytische Übersicht. Psychotherapieforschung, 28(4), 593–605. https://doi.org/10.1080/10503307.2016.1204023
- Paul, GL (1967). Strategie der Ergebnisforschung in der Psychotherapie. Zeitschrift für Beratungspsychologie, 31(2), 109–118. https://doi.org/10.1037/h0024436
- Rollnick, S., & Miller, W. (1995). Was ist motivierende Gesprächsführung? Verhaltens- und kognitive Psychotherapie, 23, 325–334. https://doi.org/10.1017/S135246580001643X